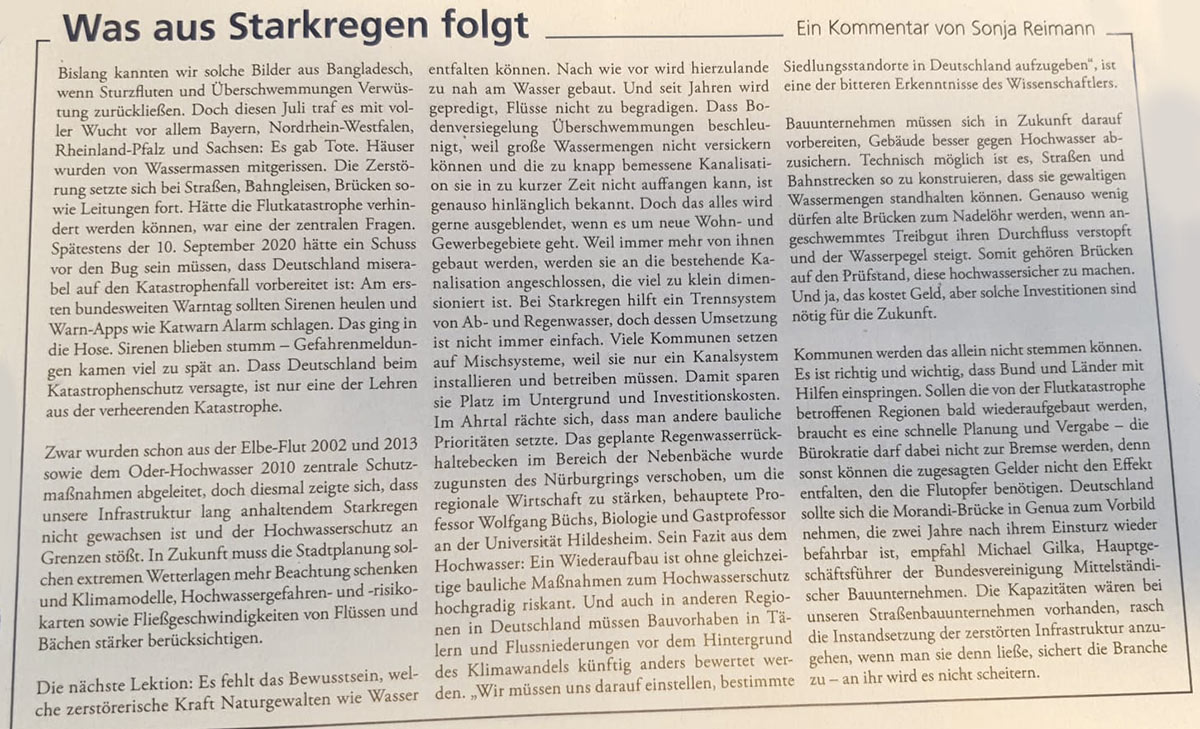Kommentar wurde von Sonja Reiman in der September/Oktober-Ausgabe #418 des Baublatt veröffentlicht und uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt.
Bislang kannten wir solche Bilder aus Bangladesch, wenn Sturzfluten und Überschwemmungen Verwüstung zurückließen. Doch diesen Juli traf es mit voller Wucht vor allem Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Sachsen: Es gab Tote. Häuser wurden von Wassermassen mitgerissen. Die Zerstörung setzte sich bei Straßen, Bahngleisen, Brücken sowie Leitungen fort. Hätte die Flutkatastrophe verhindert werden können, war eine der zentralen Fragen. Spätestens der 10. September 2020 hätte ein Schuss vor den Bug sein müssen, dass Deutschland miserabel auf den Katastrophenfall vorbereitet ist: Am ersten bundesweiten Warntag sollten Sirenen heulen und Warn-Apps wie Katwarn Alarm schlagen. Das ging in die Hose. Sirenen blieben stumm – Gefahrenmeldungen kamen viel zu spät an. Dass Deutschland beim Katastrophenschutz versagte, ist nur eine der Lehren aus der verheerenden Katastrophe.
Zwar wurden schon aus der Elbe-Flut 2002 und 2013 sowie dem Oder-Hochwasser 2010 zentrale Schutzmaßnahmen abgeleitet, doch diesmal zeigte sich, dass unsere Infrastruktur lang anhaltendem Starkregen nicht gewachsen ist und der Hochwasserschutz an Grenzen stößt. In Zukunft muss die Stadtplanung solchen extremen Wetterlagen mehr Beachtung schenken und Klimamodelle, Hochwassergefahren- und -risikokarten sowie Fließgeschwindigkeiten von Flüssen und Bächen stärker berücksichtigen.
Die nächste Lektion: Es fehlt das Bewusstsein, welche zerstörerische Kraft Naturgewalten wie Wasser entfalten können. Nach wie vor wird hierzulande zu nah am Wasser gebaut. Und seit Jahren wird gepredigt, Flüsse nicht zu begradigen. Dass Bodenversiegelung Überschwemmungen beschleunigt, weil große Wassermengen nicht versickern können und die zu knapp bemessene Kanalisation sie in zu kurzer Zeit nicht auffangen kann, ist genauso hinlänglich bekannt. Doch das alles wird gerne ausgeblendet, wenn es um neue Wohn- und Gewerbegebiete geht. Weil immer mehr von ihnen gebaut werden, werden sie an die bestehende Kanalisation angeschlossen, die viel zu klein dimensioniert ist. Bei Starkregen hilft ein Trennsystem von Ab- und Regenwasser, doch dessen Umsetzung ist nicht immer einfach. Viele Kommunen setzen auf Mischsysteme, weil sie nur ein Kanalsystem installieren und betreiben müssen. Damit sparen sie Platz im Untergrund und Investitionskosten. Im Ahrtal rächte sich, dass man andere bauliche Prioritäten setzte. Das geplante Regenwasserrückhaltebecken im Bereich der Nebenbäche wurde zugunsten des Nürburgrings verschoben, um die regionale Wirtschaft zu stärken, behauptete Professor Wolfgang Büchs, Biologie und Gastprofessor an der Universität Hildesheim. Sein Fazit aus dem Hochwasser: Ein Wiederaufbau ist ohne gleichzeitige bauliche Maßnahmen zum Hochwasserschutz hochgradig riskant. Und auch in anderen Regionen in Deutschland müssen Bauvorhaben in Tälern und Flussniederungen vor dem Hintergrund des Klimawandels künftig anders bewertet werden. „Wir müssen uns darauf einstellen, bestimmte Siedlungsstandorte in Deutschland aufzugeben“, ist eine der bitteren Erkenntnisse des Wissenschaftlers.
Bauunternehmen müssen sich in Zukunft darauf vorbereiten, Gebäude besser gegen Hochwasser abzusichern. Technisch möglich ist es, Straßen und Bahnstrecken so zu konstruieren, dass sie gewaltigen Wassermengen standhalten können. Genauso wenig dürfen alte Brücken zum Nadelöhr werden, wenn angeschwemmtes Treibgut ihren Durchfluss verstopft und der Wasserpegel steigt. Somit gehören Brücken auf den Prüfstand, diese hochwassersicher zu machen. Und ja, das kostet Geld, aber solche Investitionen sind nötig für die Zukunft.
Kommunen werden das allein nicht stemmen können. Es ist richtig und wichtig, dass Bund und Länder mit Hilfen einspringen. Sollen die von der Flutkatastrophe betroffenen Regionen bald wiederaufgebaut werden, braucht es eine schnelle Planung und Vergabe – die Bürokratie darf dabei nicht zur Bremse werden, denn sonst können die zugesagten Gelder nicht den Effekt entfalten, den die Flutopfer benötigen. Deutschland sollte sich die Morandi-Brücke in Genua zum Vorbild nehmen, die zwei Jahre nach ihrem Einsturz wieder befahrbar ist, empfahl Michael Gilka, Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung Mittelständischer Bauunternehmen. Die Kapazitäten wären bei unseren Straßenbauunternehmen vorhanden, rasch die Instandsetzung der zerstörten Infrastruktur anzugehen, wenn man sie denn ließe, sichert die Branche zu – an ihr wird es nicht scheitern.